Leseproben
„Machtlos“
Die Deutsche Ulrike Bauer wird in Kolumbien des Mordes an ihren beiden Kindern und ihrem Mann angeklagt. Obwohl sie unschuldig ist, scheinen die Beweise gegen sie erdrückend zu sein. Sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Albtraum wird wahr …
Nach fünf Jahren, in denen sie immer wieder mit dem Tod bedroht wird, gelingt Ulrike Bauer die Flucht aus dem Gefängnis. Nun versucht sie, ihre Unschuld zu beweisen und die wahren Mörder ihrer Familie zu finden. Auf ihrer Mission ist sie nicht allein: ihre Helfer und sie müssen auf ihrer Suche zu drastischen Maßnahmen greifen. Nur gut, dass diejenigen, die Ulrike unterstützen, viel Erfahrung mit ungewöhnlichen und höchst gefährlichen Fällen haben …
Foxfire sind zurück – und begeben sich auf eine atemlose Jagd nach den Drahtziehern dieser Intrige, die im Dschungel von Kolumbien beginnt und sich über Kontinente erstreckt. Heidrun Bücker ist mit „Machtlos“ wieder ein spannender Thriller gelungen, in dem starke Frauen ihre eigenen Wege finden, um für Gerechtigkeit zu sorgen.
Prolog:
Kolumbien!
Die Flucht war geglückt, aber ob es hier in dem Versteck wirklich sicher war, konnte sie nur hoffen. Ihre Helfer hatten ganze Arbeit geleistet. Aus dem Hochsicherheitstrakt des Staatsgefängnisses zu entkommen, grenzte an ein Wunder.
Am liebsten wäre sie sofort aus diesem verdammten Land geflohen, wäre nach Hause zurückgekehrt, nach Deutschland. Aber leider ging das nicht. Sobald sie deutschen Boden betreten hätte, wäre sie verhaftet und vermutlich wieder nach Kolumbien ausgeliefert worden. Es nützte ihr nichts, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft besaß. Das Gesetz war in diesem Punkt unnachgiebig. Bei Mord kannte man kein Pardon.
Ulrike Bauer saß seit fünf Jahren in einem Gefängnis in Kolumbien. Das Urteil war schnell gesprochen und lautete auf vorsätzlichen dreifachen Mord. Das bedeutete lebenslange Haft.
Ulrike Bauer war erst achtunddreißig Jahre alt, als man sie anhand von eindeutigen Beweisen verhaftete. Fünf qualvolle Jahre hatte sie abgesessen, bis ihr mithilfe guter Freunde, die alle an ihre Unschuld glaubten, die Flucht aus dem Hochsicherheitstrakt gelang.
Der erste, leichtere Teil war geschafft. Nun galt es, die wahren Mörder ihres Mannes und ihrer beiden Kinder zu finden.
Das Versteck wäre sicher, sagten ihre Freunde, dennoch sollte sie besser nicht die Unterkunft verlassen. Versorgt mit den wichtigsten Lebensmitteln, konnte sie nicht verhungern. Ihre Gesamtsituation hatte sich eigentlich nicht verbessert. Das Haus befand sich inmitten einer unwegsamen Gegend. Hierher verirrte sich niemand, und niemand vermutete, dass in der halb verfallenen Hütte jemand lebte.
Ulrike Bauer schaute vorsichtig aus dem maroden Holzfenster ihrer Unterkunft, konnte keine Bewegung außerhalb feststellen und setzte sich beruhigt auf einen der alten Holzstühle.
Immer wieder zuckte sie bei jedem noch so kleinen Geräusch zusammen. Die fünf brutalen Jahre, die sie in Haft verbringen musste, waren grausam gewesen. Nicht nur innerliche, auch äußerliche Narben hatte sie davongetragen.
Ihre einzige Freundin in Kolumbien, Kerstin Gärtner, ebenfalls eine Deutsche, hatte es geschafft, sie hin und wieder im Gefängnis besuchen zu können, und ging damit ein hohes Risiko ein. Sie wohnte damals im Nachbarhaus und hatte die Entführung ihrer Kinder beobachtet. Sie sagte auch vor Gericht zu Ulrikes Gunsten aus. Leider glaubte man ihr nicht.
Kerstin wusste genau, dass sie unter Beobachtung stand, man verfolgte sie auf Schritt und Tritt. Sie befürchtete, das gleiche Schicksal wie Ulrike zu erleiden, sollte sie weiterhin versuchen, ihre Freundin im Gefängnis zu besuchen. Deshalb nahm sie Kontakt zu Ulrikes Anwalt, Frederico Solano, auf.
Ulrike vertraute ihm. Kerstin blieb skeptisch. Leider waren die Beweise vor Gericht so massiv, dass auch er hilflos mit ansehen musste, wie seine Mandantin zu einer dreifachen lebenslangen Haftstraße verurteilt wurde.
Deshalb war die einzige Möglichkeit, Ulrike zu helfen, die Rettungsaktion von Deutschland aus zu steuern.
Frederico Solano kopierte sämtliche Akten des Prozesses und schickte sie zu Kerstin. Leider war es strikt verboten, den Häftlingen diese Dokumente zukommen zu lassen. Da auch Besuche untersagt waren, musste sich Kerstin zunächst in Deutschland selbst in die Unterlagen einlesen. Eine sehr lange Liste mit noch mehr Fragen lag neben dem Aktenstapel. Per Mail nahm sie Kontakt zu Solano auf. Er hatte als Einziger die Möglichkeit, seine Mandantin alle drei Monate im Gefängnis zu besuchen. Da der Prozess abgeschlossen war, eine Wiederaufnahme als aussichtslos abgeschmettert wurde, konnte er nicht von seinem Recht Gebrauch machen, seine ehemalige Mandantin mehr als einmal vierteljährlich aufzusuchen.
Kerstin sandte ihm die Fragen zu, die ihr auf der Seele brannten. Die Unterlagen, die der Anwalt ihr zuschickte, vermittelten ihr den Eindruck, nicht vollständig zu sein. Dass ihre Freundin, die sie jahrelang kannte, ihren Ehemann und die beiden Kinder grundlos ermordet haben sollte, war eins der Rätsel, die sich niemand erklären konnte. Kerstin hatte die Verhandlung als Zuschauerin verfolgt. Meist waren keine Sitzplätze im Verhandlungssaal zu ergattern, denn der Prozess wirbelte eine Menge Staub auf.
Schon während der Verhandlung fielen ihr immer wieder Ungereimtheiten auf. Ulrike Bauer hatte die Leichen ihres Mannes und die der Kinder nie persönlich identifizieren dürfen. Der Zeuge, der ihr Alibi für die Tatzeit bestätigen könnte, wurde nicht befragt.
„Völlig belanglos“, urteilte der Richter, ein älterer, kahlköpfiger Mann, Mitte sechzig, klein und rundlich. Ein dicker Siegelring protzte an seinem rechten Ringfinger.
Ein Dolmetscher übersetzte zwar ihre Antworten während der Verhandlung, aber Kerstin vermutete, dass er es mit den Fragen des Staatsanwaltes nicht so genau nahm. Frederico Solano versuchte einzugreifen, aber der Richter ließ ihn nicht zu Wort kommen.
Ein abgekartetes Spiel? Die Vermutung lag nahe, konnte aber weder bewiesen werden noch hatte Ulrike die Möglichkeit, sich Notizen während des Prozesses zu machen. Ihre Hände blieben in Handschellen und waren seitlich an ihrem Stuhl fixiert. Selbst wenn sie ein Blatt Papier und einen Stift gehabt hätte, wäre schreiben nicht möglich gewesen. Es grenzte an Folter, stundenlang in dieser starren Haltung sitzen zu müssen.
Fünf Jahre lang hatte Ulrike Bauer Zeit, sich Gedanken über die Geschehnisse zu machen, kam aber zu keinem einleuchtenden Resultat. Die Zeit im Gefängnis hatte sie hart werden lassen, die einzige Möglichkeit, um hinter diesen Mauern zu überleben. Ihre Mitgefangenen gingen nicht gerade wohlwollend mit ihr um, und da sie über keinerlei Barmittel verfügte, konnte sie sich keine Freunde kaufen.
Sie lernte sich zu verteidigen, sich zu wehren, wurde selbst zu einer dieser gewalttätigen Frauen, die sie normalerweise verachtete. Hier ging es ums reine Überleben, egal wie. Nachdem sie endlich begriffen hatte, wie die Hierarchie in einem Staatsgefängnis von Kolumbien funktionierte und sie keine Skrupel mehr hatte, zurückzuschlagen, konzentrierte sie sich auf ihre Flucht.
Ein Unterfangen, von dem ihre Mitgefangenen ihr abrieten: „Aus diesen Mauern hat es noch nie jemand geschafft, zu fliehen. Vergiss es.“
Vergessen wollte und konnte sie es nicht.
Nach einem Jahr erhielt sie eine neue Zellengenossin. Sie war nicht so brutal, gewissenlos und gewalttätig wie ihre Mitbewohnerinnen zuvor. Ulrike freundete sich mit ihr an. Conztanza war erst dreiundzwanzig, klein, zierlich und musste erst noch die harte Schule des Gefängnisses kennenlernen. Sie wurde mit einem blauen Auge und zwei Platzwunden im Gesicht zu Ulrike in die Zelle gebracht.
Ulrike versorgte die Wunden. Ärztliche Behandlung war in diesem Fall nicht üblich. Wenigstens erhielt sie Pflaster und ein Desinfizierungsmittel, so konnte Ulrike die Wunden zumindest säubern.
Conztanza zuckte zurück, als Ulrike sich der ersten Platzwunde annahm. Mittlerweile war ihr Spanisch perfekt, aber das wusste niemand. Mit dem Wachpersonal sprach sie nicht, mit ihren Mitgefangenen nur ein gebrochenes, stümperhaftes Kauderwelsch.
In ihrer Zelle übte sie fleißig, sobald sie alleine war, was nicht häufig vorkam. Nach einem Jahr verstand sie jedes Wort, nur mit der Aussprache meinte sie, würde es noch hapern.
Conztanza dachte, Ulrike wäre genauso unmenschlich wie die anderen Häftlinge. Ulrike flüsterte ihr auf Spanisch zu: „Keine Angst, ich tue dir nichts. Halt einfach nur still, damit ich deine Wunden versorgen kann.“
Conztanza hob verwundert den Kopf: „Du sprichst meine Sprache? Man hat mir gesagt, ich käme in deine Zelle, weil du mich nicht verstehen würdest.“
„Dann posaune dein Wissen nicht gleich aus. Belassen wir es dabei, dass die anderen glauben, ich würde sie nicht verstehen und wir würden uns nicht verständigen können.“
Conztanza versprach es.
„Wir werden den anderen noch eine bühnenreife Showeinlage bieten, damit sie meinen, wir würden uns hassen. Wenn du mitspielst, werden sie ihre Genugtuung dabei haben, uns zusammenzulassen.“
Erleichtert atmete Conztanza auf. Ulrike hoffte, in der nächsten Zeit nicht mehr von den Mithäftlingen belästigt zu werden, obwohl sie mittlerweile genau wusste, wie sie sich gezielt gegen diese Angriffe zur Wehr setzten konnte.
Nach zwei Wochen waren Conztanzas Wunden verheilt. Die beiden trainierten in ihrer engen Zelle, um fit zu bleiben. Es war nicht einfach, aber die Enge hinderte sie nicht, tatkräftig zu üben. Gewichte besaßen sie nicht, also begnügten sie sich mit den Dingen, die in der Zelle vorhanden waren: sie selbst. Ulrike stemmte Conztanza, und die schmächtige dunkelhaarige Kolumbianerin probierte immer wieder Ulrike hochzuheben. Eine Beschäftigung, die gut gegen ihre Langeweile war, denn es wurde ihnen noch nicht einmal ein Buch oder ein Hofrundgang gestattet.
In ihren Trainingspausen unterhielten sie sich über ihren jeweiligen Prozess, über die Taten, die sie angeblich begangen haben sollten, und wieder kristallisierte sich heraus, dass man hier die Menschen wahllos beschuldigte, verurteilte und für Jahre hinter Gitter steckte.
Conztanza wurde des Diebstahls beschuldigt und sollte die nächsten zehn Jahre im Hochsicherheitstrakt des Staatsgefängnisses absitzen. „Ich habe gestohlen, um meine Familie zu ernähren. Ein weniger schweres Delikt, aber während des Prozesses kam dann der
leitende Ermittlungsbeamte plötzlich an und präsentierte eine Tüte mit harten Drogen, die er angeblich in meinem Zimmer unter dem Bett gefunden haben will.“
„Und?“ Ulrike wurde neugierig. „Waren es deine?“
„Nein. Aber wegen Drogenbesitz kam ich dann doch hierher in den Hochsicherheitstrakt.“
„Warum wollte man dich denn dann hinter Gitter sehen?“
Conztanza zuckte mit den Schultern. „Ich habe keine Ahnung.“
„Überlege …, was ist in den Tagen zuvor passiert? Wo warst du da? Wem bist du begegnet? Was hast du gemacht?“
„Du stellst merkwürdige Fragen …“
„Ich denke, wir beide sind irgendjemandem auf die Füße getreten. Wir haben etwas gesehen, was wir nicht sehen durften.“
„Aber wir beiden kannten uns doch vorher gar nicht. Du bist doch schon länger hier drin als ich.“
„Stimmt, wenn wir den gemeinsamen Nenner finden, wissen wir vermutlich auch, warum man uns aus dem Weg schaffen will.“
„Pah“, kam es von Conztanza, „dann wäre es doch vorteilhafter gewesen, man hätte uns umgebracht. Dann wäre das leidige Thema ein für alle Mal erledigt.“
„Stimmt, aber bei mir würde man Fragen stellen, ich komme aus Deutschland. Die deutsche Botschaft hatte sich zwar kurz eingeschaltet, wollte aber nichts unternehmen.“
„Lass uns weiter trainieren und dabei überlegen, welchen gemeinsamen lieben Freund wir vergrault haben könnten.“
Nach weiteren drei Monaten harter Übung schaffte Conztanza es, Ulrike hochzuwuchten. Ihre Freude war groß, sie jubelte laut. Ulrike zuckte zurück und fing lauthals an zu fluchen.
„Verdammt, du blödes Miststück, dir werde ich es zeigen“, sie schlug hart auf das Kopfkissen ein und schrie zeitgleich, „Aua …!“
Conztanza wusste im ersten Moment nicht, was los war. Ulrike flüsterte ihr zu: „Du kannst nicht einfach freudig jubeln, denk daran, wir sind verfeindet. Schrei einfach laut.“
Conztanza begriff und klatschte ebenfalls gegen ihre eigene Hand. Sie schrien, sie kreischten, es hörte sich nach einem harten Kampf an.
Den Streit konnte man noch einige Kerker weiter hören. Niemand würde ihre Zelle betreten, niemand würde nachschauen, was dort passierte. Vor neugierigen Blicken waren sie sicher.
Später lachten sie leise.
„Hat geklappt“, sagte Ulrike, „Glück gehabt. Die sollen weiter der Meinung sein, wir erschlagen uns demnächst gegenseitig.“
Sie sollten recht behalten.
In den nächsten Wochen erzählte Ulrike ihrer Zellengenossin, wie sie in diesem menschenunwürdigen Gefängnis gelandet war.
„Skrupellos“
Leseprobe
Prolog
Duisburg – Herzklinik, Intensivstation
Vanessa hielt die warme Hand ihres Mannes. Ihr war bewusst, dass er in wenigen Minuten tot sein würde, dass er eigentlich schon jetzt nicht mehr lebte. Die Intensivstation wurde von Tönen überflutet, die sie nervös machten. Ein unerträglicher sinnüberflutender Geräuschpegel von Maschinen, die dazu dienten, die Brust anzuheben, Luft einzupumpen, um sie dann mit einem Zischen entweichen zu lassen. Sie wusste, sobald die Maschinen ausgeschaltet wurden, gab es keine Zukunft mehr. In diesem Moment starrte sie nur noch auf eine leere Hülle. Zwar sah diese so aus wie der Mann, mit dem sie zweiundvierzig Jahre lang verheiratet war, aber eine Reaktion, eine Geste, ein Lächeln … all das war nicht mehr. Diese Geräte konnten noch tagelang einen Herzschlag simulieren. Die aktuelle Medizintechnik war dazu imstande.
Erschrocken zuckte sie zusammen.
Theos Augenlider flackerten. Sollte die Chance bestehen? Nein. Unmöglich. Die Prognose der Ärzte war eindeutig und sagte etwas anderes.
Multiples Organversagen.
Heilungschancen: null.
Er wird nie wieder nach Hause kommen, dachte sie, er wird nie wieder in seinem Sessel sitzen, wir werden nie wieder miteinander reden, und ich werde nie wieder seine Hand halten können … Es war die Endgültigkeit, die sie nicht zur Ruhe kommen ließ.
Es war zu spät, noch etwas zu unternehmen. Diese Möglichkeit hatte sie verpasst, als ihr Mann noch in dem anderen Krankenhaus lag. Sie machte sich die allergrößten Vorwürfe. Im Grunde war sie schuld. Im Grunde hatte sie ihren Mann auf dem Gewissen, weil sie nicht rechtzeitig reagiert hatte.
Warum habe ich nicht dafür gesorgt, dass er in ein anderes, besseres Krankenhaus verlegt wird, wo man sich auch um die Patienten kümmert? Warum habe ich im Innersten gehofft, dass ich mich irre und er doch nicht so schwer krank ist? Warum habe ich den Ärzten im anderen Krankenhaus geglaubt, es wäre nicht so schlimm, eigentlich harmlos …
„Ein paar Tabletten, einige Wochen Schonung und Ihrem Mann geht es wieder besser. Lungenentzündung halt. Für ältere, geschwächte Menschen bei der kalten Jahreszeit nicht optimal. Sobald sich das Wetter bessert, so-bald die Sonne scheint, dann wird es wieder aufwärtsgehen. Ihr Mann kann nach Hause, wir benötigen hier Platz für wirklich kranke Menschen.“
„Kann es nicht doch ein Herzinfarkt sein“, wagte sie nachzufragen, „oder zumindest eine Erkrankung am Herzen? Die Schmerzen in der linken Brust, im linken Arm und in der linken Schulter. Er bekommt doch keine Luft … das ist doch eindeutig.“
„Lassen Sie uns unsere Arbeit machen“, die Ärztin wurde ungehalten, „wir haben die erforderlichen Untersuchungen gemacht. Ihr Mann hat nur eine leichte Lungenentzündung. Mit Antibiotika geht es ihm bald besser.“
Sie hatte letztendlich der Ärztin geglaubt, bevor diese eilig in einem anderen Patientenzimmer verschwunden war. Im Nachhinein war sie sich nicht einmal sicher, ob diese Ärztin überhaupt wusste, um welchen Patienten es ging.
Sechs Wochen später lag ihr Mann in der Herzklinik in Duisburg. Die zwölfstündige OP war vergeblich gewesen. Sie hatte die Entscheidung allein treffen müssen und zugestimmt: Die lebenserhaltenden Maßnahmen würden gleich abgeschaltet werden.
Sie erinnerte sich an die letzten Schritte, die sie und ihr Mann gemeinsam machten. Es war vor vierzehn Tagen auf dem Weg zum Krankenwagen. Die Sanitäter meinten, der Zustand ihres Mannes sei nicht so bedrohlich, als dass man ihn tragen müsste. Er war geschwächt und wankte. Sie hörte, wie ein Sanitäter dem anderen zuraunte: „Der ist ja jetzt schon angetrunken.“ Vanessa reagierte nicht auf diese beleidigende Äußerung. Sie stützte ihn. Allein schaffte er die wenigen Meter bis zum Krankenwagen nicht. Zwei Stunden nach seiner Einlieferung lag er bereits in einem der speziell eingerichteten Zimmer und war an Monitore und anderen Überwachungsgeräte angeschlossen. Sein Zustand verschlechterte sich stündlich.
Nach vier Tagen wurde er endlich nach Duisburg verlegt, als die Ärzte es doch für erforderlich hielten, ihn gründlich zu untersuchen und endlich feststellten, dass er lebensbedrohlich erkrankt war.
Zu spät.
In wenigen Minuten würde man die Maschinen abstellen … in wenigen Minuten würde ihr Mann tot sein.
Sie wünschte sich, ihre Tochter wäre an ihrer Seite. Doch die war für eine Hilfsorganisation einige tausend Kilometer entfernt unterwegs. Sie konnte sie nicht erreichen. Schon seit einigen Wochen meldete sie sich nicht mehr. Sie war wie vom Erdboden verschwunden, ebenso wie einige andere Helfer, die für diese Organisation arbeiteten. Zunächst hieß es nur, es wäre eine ansteckende Krankheit ausgebrochen, und man habe alle Beteiligten in einem Krankenhaus unter Quarantäne gestellt. Aber warum konnten sie nicht wenigstens telefonieren?
Sie zuckte zusammen, als der Oberarzt noch einmal zu ihr kam. Er blieb an der Tür stehen und wartete.
Sie nickte ihm zu.
Nun war es endgültig.
Vanessa schaute ein letztes Mal zu Theo, berührte ein letztes Mal seine Hand, strich ihm ein letztes Mal über die Wange und verließ mit tränenverschleierten Augen das Zimmer …
Leseprobe:
„Verlorene Spur“
Corinna leidet unter einer Amnesie, hervorgerufen durch einen Mordanschlag in Ägypten, bei dem ihr erster Ehemann und drei der Beschützer getötet wurden. Nur ihr 10 Monate alter Sohn und sie selbst konnten durch den Bodyguard Leonard Benders von der Sondereinheit Foxfire gerettet werden. Seit siebzehn Jahren lebt Corinna ohne Vergangenheit. Sie hat mittlerweile Leonard geheiratet und gehört ebenfalls zum Foxfireteam, da ungeahnte Talente in ihr schlummern, wie sie trotz der Amnesie feststellen musste.
Nur gelegentliche Flashbacks lassen sie sekundenlang in ihre Vergangenheit schauen. Sie wird fast jede Nacht von Augen verfolgt, sie wollen ihr etwas sagen… leider dauern diese Illusionen nie lange an und sie kann nicht sagen, ob es sich nur um einen Traum handelt, oder ein Hinweis auf ein Ereignis aus ihrer Vergangenheit ist. Noch immer weiß niemand, wer hinter dem Mordanschlag an ihrem ersten Mann, einem Wissenschaftler steckt, der in einer Forschungsabteilung des Außenministeriums arbeitete.
Als endlich die Mauer, die sich um ihre Erinnerungen gelegt hatte zusammenbricht, ist es für Corinna ein Schock… es ist alles ganz anders, als sie bislang aus den alten Berichten in Erfahrung bringen konnte. Jemand aus ihrer unmittelbaren Umgebung scheint sie jahrelang hintergangen zu haben.
Um die Mörder zu fassen, muss sie ihnen eine Falle stellen. Corinna fliegt 17 Jahre nach dem Attentat wieder zurück, zurück nach Ägypten, nach Luxor, zur West Bank…
Letztendlich siedelt sich die Sondereinheit des Außenministeriums „Foxfire“ sogar in der Feldmark an. Zwischen den Einsätzen der Agenten, zu denen auch Charly, eine Frau und Scharfschützin im aktiven Einsatz gehört, wohnen sie in dem Dorstener Stadtteil, das überaus perfekt zur Autobahnauffahrt Kirchhellen Nord liegt und über ein großes Feld hinter dem Haus der Protagonistin Corinna verfügt, auf dem sogar die Helikopter landen können.
Natürlich gibt es auch gefährliche Schießereien in der Feldmärker Nachbarschaft, als ein Bösewicht versucht, einige Mitglieder Foxfires auszuschalten. Aber diese elitäre Einheit wäre nicht Foxfire, wenn sie nicht den Feind gnadenlos ausschalten würde.
*****
Die Handlung und alle Personen in diesem Buch sind frei erfunden. Alle möglichen Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Vorgängen oder Ereignissen bzw. mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig…. — oder auch nicht
Verlorene Spur
1995, Ägypten – Luxor – West Bank
Brütende Hitze lag über dem Fluss. Lästige Insekten surrten um ihren Kopf, schwirrten und krabbelten auf den wenigen Stellen ihrer Arme und Beine herum, die nicht mit Stoff bedeckt waren. Der Müll am Flussufer stank bis hierher. Zerrissene Plastiktüten flogen durch die Luft. Irgendwelche toten Tiere trieben nahe dem Ufer entlang oder hatten sich dort im Schlamm festgesetzt. Bewegungslos harrte sie im Schilf aus und beobachtete die Sumpflandschaft. Ab und zu schweiften ihre Blicke über das Maisfeld hinüber zum Haus.
Es war schwül, obwohl es erst Anfang März war. Sie fluchte, eine neue Angewohnheit von ihr, verdammte die Menschen, die dafür verantwortlich waren, dass sie in diesem Land war. Wie sollte es erst im Sommer werden, wenn man es im Frühjahr kaum aushielt? Die Hoffnung, dann zurück in Deutschland zu sein, schminkte sie sich ab. Was gäbe sie für eine Scheibe Graubrot und frisch aufgebrühten, richtigen Kaffee. Dieses lösliche Zeug. Sie schüttelte sich, sie verabscheute all das, obwohl sie noch nicht lange hier lebte.
Leben? Nein. Dahinvegetieren konnte sie es nur nennen. Sie schwelgte in Erinnerungen, dachte an Deutschland, erinnerte sich an das kühle Regenwetter, an Schnee und nahm sich vor, sollte sie zurück sein, würde sie nie wieder über das deutsche Wetter meckern …Sie war so tief in ihren Gedanken versunken, dass sie eindöste. Das sich nähernde Motorengeräusch überhörte sie – zunächst.
*
„Willkommen in der Hölle, neu hier?“ Leonard Benders nickte und grunzte mürrisch, als er von der Rückbank des verbeulten Jeeps seine Reisetasche nahm. Seine miese Laune besserte sich nicht, als er sich den Ort anschaute, zu dem er von seinem neuen Arbeitgeber, Foxfire, geschickt worden war.
Seit er für die Organisation arbeitete, lernte er die Welt kennen. Seine Aufenthalte in den jeweiligen Krisengebieten dauerten allerdings nicht lange an. Als gelernter Wirtschaftsprüfer hatte er täglich mit Zahlen zu tun. Das wurde ihm langsam, aber sicher langweilig. So entschloss er sich, bei seinem ehemaligen Freund und Kollegen mit einzusteigen, der für das Außenministerium eine Sondereinheit aufbaute. Sein Freund benötigte gerade Leute mit einer Nahkampfausbildung und einem abgeschlossenen Studium, vorzugsweise in seinem Bereich. Einen Anwalt konnte er auch schon für sich gewinnen. So nahm er den Job an, der wesentlich interessanter war, als täglich mit Zahlen zu jonglieren.
„Was hast du ausgefressen?“ Benders hob missbilligend seine rechte Augenbraue. „Kevin. Kevin Mondal.“ Er lachte auf. „Wer hier landet, wurde strafversetzt. Ulli und Michael ebenfalls“, er deutete auf zwei andere Männer, die etwas entfernt unter einem großen Baum im Schatten saßen und rauchten. „Du bist die Ablösung für Ulli, der darf nach Hause. Dafür bist du nun hier. Ein oder zwei Monate, und du darfst zurück in die Zivilisation.“
Kevin steckte sich eine Zigarette an und ließ seinen Blick schweifen. Endlich bequemte sich Leonard zu antworten.
„Leonard Benders. Und wie lange musst du noch?“
„Ich hoffe, nur noch vier Wochen. “
„Was machen wir hier eigentlich?“
„Wir bewachen einen Wissenschaftler und seine Familie. Seine Frau ist gerade mit dem Kind zum Ufer des Nils gegangen, das macht sie häufig, da weht etwas Wind, meint sie. Der Kleine, ein Junge, ist zehn Monate alt. Der Professor ist im Haus und arbeitet.
„Warum sind sie hier? Es sind doch Deutsche. Konnte man sie nicht woanders unterbringen?“
„Sie sind nun schon fünf Monate auf der Flucht, Deutschland wurde zu unsicher, nach zwei Tagen wurden wir jedes Mal aufgespürt und mussten weiter. Wie oft wir flüchten mussten, kann ich gar nicht mehr sagen. Hier sind wir schon zwei Monate, und man hat uns noch nicht gefunden.“
„Verstehe, deshalb hat man mir nicht gesagt, wohin es geht. Mittlerweile habe ich einen umständlichen Weg hinter mir. Frankfurt – London – Dubai – Kairo und nun Luxor.“
Kevin nickte. „Er ist Wissenschaftler, hat irgendetwas entdeckt, glaube ich. Irgendwer ist hinter ihm her, mehr wissen wir auch nicht. Habe gehört, er würde auch für unseren Verein arbeiten, in einer Forschungsabteilung. Zwei Mordversuche hat er hinter sich, und nun sind wir an der Reihe, ihn zu beschützen.“
„Wie heißt er? Lerne ich ihn kennen, oder ist er so ein arrogantes Arschloch, das er nicht mit uns spricht?“
Kevin schüttelte den Kopf, zog ein letztes Mal an seiner Zigarette und drückte sie aus.
„Die Familie ist adelig, hat Geld, ist aber nicht hochnäsig. Im Gegenteil. Du wirst sie nachher kennenlernen. Wir duzen uns und essen sogar alle zusammen, darauf haben beide bestanden. Corinna ist froh, wenn sie Unterhaltung hat, und Noah, der Kleine, ist niedlich und lacht stets. „Corinna und Noah? Und wie heißt der Professor?“
„Victor von Blankenheim-Solbach“, erklärte Kevin, „Professor Dr. von Solbach – unter diesem Namen wurde er bekannt.“
Leonard stockte.
„Gott, den bewachen wir? Verstehe. Ging ja wochenlang durch die Presse. Ich dachte, der ist tot.“
„Nein, aber es muss einen Maulwurf in unseren Reihen geben“, erklärte Kevin weiter. „Deshalb besprachen wir die Flucht nach Luxor nur noch mit unserem direkten Vorgesetzten Wallner, und erst jetzt, nachdem niemand weiß, wo wir sind, können wir durchatmen.“
„Gut, dann lass uns hineingehen, damit ich den Professor kennenlerne.“
Leseprobe
„Tanz mit dem Teufel“
Delia schaute auf die Armbanduhr, wenn sie sich beeilte, könnte sie in einer Stunde im Hotel sein. Marcel würde schon ungeduldig warten. Ob es ihm besser ging?
Sie hasste diese trübe Jahreszeit und hasste späte Termine an fremden Orten, die sie nicht kannte, und sie verabscheute es, alleine ins Hotel zurückfinden zu müssen. Das Navi konnte sie nicht gebrauchen, seit sie diese dämliche Umleitung passiert hatte. Keinerlei Angaben, wo sie sich befand. Nur die Ansage, dass sie umdrehen sollte. Laut Navi fuhr sie durch Niemandsland. Mist, es war so dunkel, hier in den Bergen, dass selbst die Scheinwerfer kaum eine Lichtschneise auf die Straße werfen konnten.
Die Serpentinstraße schraubte sich unaufhaltsam in die Höhe.
Und dann noch diese andere Sache, die ihr keine Ruhe ließ. Ihre Gedanken schweiften ab. Hatte sie es vor wenigen Tagen richtig bemerkt? Und dann auch noch Ulla, ihre Assistentin und rechte Hand. Sie entdeckte die Unstimmigkeiten in den Buchführungsunterlagen. Zahlungen an eine Firma, die es scheinbar nicht gab. Oder?
Steckte Frank Meller dahinter, ihr neuer Prokurist? Sie hatte ihn kürzlich gesehen … mit diesem Dr. Klein, der in der Nähe eine Privatklinik betrieb. Marcel war auch dabei … Sie unterhielten sich angeregt, vertraut, fast so, als würden sie sich alle drei schon länger kennen.
Zweifel!
Sie war sich nicht sicher. Vielleicht …
Sollte sie vorher mit Marcel sprechen? Ihr Ehemann interessierte sich nicht für die Firma, dennoch – als Bekannter ihres Prokuristen konnte er ihr vielleicht etwas über diesen zwielichtigen Mann erzählen, der ihr eigentlich zuwider war und den sie doch auf sein Anraten hin einstellte. Was hatten sie beide mit Klein zu besprechen?
Konzentriere dich auf die Straße, ermahnte sie sich zum wiederholten Male, hier kennst du dich nicht aus, es ist dunkel, stockfinster, einsam. Es fing an zu regnen. Wieder schweiften Delias Gedanken ab.
Er ließ sie nicht in Ruhe, dieser bohrende Zweifel, sie musste unbedingt mit jemandem darüber reden, mit jemandem, dem sie vertrauen konnte. Antonio kam ihr in den Sinn, aber er würde bald wieder nach Argentinien abreisen. Blieb nur noch Adrian, ihr Schwager.
Es war nur dieses winzige Detail, das sie hellhörig werden ließ, als Meller erwähnte, diesen Arzt, Dr. Klein, nicht zu kennen. Sie stutzte kurz, hoffte, dass ihr Gegenüber es nicht während der Besprechung bemerkt hatte, und schüttelte dann sofort wieder das aufkeimende Unbehagen ab.
Der Bordcomputer zeigte an, dass es die falsche Richtung war. Sie vermisste ein weiteres Umleitungsschild. Hatte sie ein Schild übersehen? Eine Abzweigung, eine Straßenkreuzung? Hier war es so einsam, dass sie auf die Tankuhr schaute und hoffte, nicht gerade hier in der Wildnis wegen benzinmangel anhalten zu müssen. Nein, der Tank war noch fast voll. Sie schaute zu ihrer Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, in der sich ihr Handy befand. Konnte sie wagen, es herauszuholen? Lieber nicht, besser das Lenkrad festhalten. Kein anderes Fahrzeug vor oder hinter ihr, absolute Dunkelheit, Stille und Einsamkeit.
Ein mulmiges Gefühl machte sich in ihrem Innern breit. Die Straße wurde immer schmaler, rechts neben ihr, hohe Felsen, unter ihr die gnadenlose Tiefe und kein Platz zum Wenden.
Die Konferenz hatte länger gedauert, als sie gedacht hatte. Marcel blieb im Hotel, da es ihm nicht gut ging. Kurz bevor sie losfuhr, bat sie an der Rezeption, man solle einen Arzt rufen. Während einer kurzen Pause versuchte sie Marcel zu erreichen, wollte sich erkundigen, wie es ihm ging, und was der Arzt gesagt hatte. Sie konnte ihn aber telefonisch nicht erreichen. Bevor sie zurückfuhr, versuchte sie es erneut, Marcel meldete sich nicht. Sie beeilte sich, wollte schnell zurück … und dann diese Umleitung, inmitten der Berge.
Zuerst bemerkte sie ihn nicht, den Wagen, der unaufhaltsam aufschloss. Die Scheinwerfer näherten sich, ein waghalsiges Überholmanöver des kleinen Sportflitzers, und die Straße hinter ihr hüllte sich wieder in nächtliche Schwärze.
Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte sie den Fahrer des anderen Wagens erkannt zu haben, aber nein, es konnte nicht sein. Frank Meller fuhr ein anderes Auto, einen BMW Z3. Der stand gerade noch vor dem Hotel, in dem Meller auch ein Zimmer bewohnte. Es war ein Alfa Spider, den sie gerade gesehen hatte. Was sollte Meller auch hier, in den einsamen Serpentinenkurven der Alpen? Der Wagen entfernte sich schnell aus ihrem Blickfeld, und wenige Augenblicke später tauchte sie wieder in die völlige Dunkelheit. Ihre Scheinwerfer bohrten sich in die Nacht. Nach weiteren fünf Minuten bemerkte sie erneut Lichter, diesmal vor sich. Gut, dann gab es doch noch Hoffnung, irgendwo eine Abzweigung zu finden, von der aus sie zu ihrem Hotel gelangen könnte. Laut ihrem Navi befand sie sich in einem freien Feld, keine Straße weit und breit, die Stimme schwieg, sagte ihr noch nicht einmal mehr, dass sie umdrehen sollte. Die Lampen näherten sich langsam, fuhren vorbei, und erneut war sie alleine. Fünf Minuten noch, dann werde ich anhalten, und wenn es mitten auf der Straße ist, dachte sie. Ich muss versuchen, Marcel zu erreichen. Ich weiß einfach nicht mehr, wo ich bin. Ein Blitz hinter ihr … Sie warf einen Blick in den Rückspiegel, konnte aber nichts Ungewöhnliches sehen.
Nein, kein Blitz, ein Auto. Scheinwerfer. Sie näherten sich. Der Wagen fuhr dicht auf. Verdammt, warum konnte er nicht Abstand halten? Das Auto klebte an ihrer hinteren Stoßstange, fuhr mit aufgeblendetem Licht so dicht auf, dass sie nichts mehr sah und fast blind fuhr. Die Strecke war zu kurvenreich, als dass sie es wagen konnte, das Handy aus der Tasche zu fischen. Mit einem Mal wurde ihr glasklar bewusst, dass sie verfolgt wurde. Fest umklammerte sie das Lenkrad ihres roten Jaguars.
Reiß dich am Riemen, ermahnte sie sich, schau auf die Straße, konzentriere dich.
Sie musste an ihren Vater denken, der ihr einmal sagte: Gerate nicht in Panik, wenn irgendetwas nicht klappt, Furcht und Angst, gepaart mit Unsicherheit, führen unweigerlich in den Untergang.
Wenn ich in Panik gerate, führt es unweigerlich in den Abgrund, dachte sie, als das Auto hinter ihr nochmals Gas gab und sie heftig anstieß.
Schockiert hielt sie das Steuer noch fester in der Hand, versuchte zu beschleunigen, konnte aber die Straße kaum erkennen. Der Regen wurde stärker. Wieder stieß der andere Wagen ungestüm gegen ihre Stoßstange und ließ sich dann zurückfallen. Noch konnte sie sich mühsam auf der Straße halten, geriet kurz ins Schliddern, hatte ihren Wagen aber sofort wieder unter Kontrolle. Nun gab der andere wieder Gas, quetschte sich zwischen den Jaguar und die Felswand, machte einen Schlenker nach links und stieß nun seitlich gegen ihr Auto. Der Abgrund kam näher, sie versuchte dagegen zu steuern, als der andere Wagen erneut so heftig zustieß, dass sie die Kontrolle verlor. Sie konnte das Lenkrad nicht mehr halten und scherte nach links aus, der Abgrund kam näher, sie trat auf die Bremse, der fremde Wagen schoss an ihr vorbei, der Jaguar geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und stürzte den Abhang hinunter.
Der Gedankenblitz der ihr Gehirn Sekunden später erreichte, ließ sie in aller Klarheit erkennen, dass ihre Ahnungen der letzten Wochen nicht aus der Luft gegriffen waren. Also doch!
Man wollte sie umbringen! Sie schrie auf.
Wie in Zeitlupe fiel der Jaguar in die Schlucht, überschlug sich, landete schräg auf dem Dach, wurde gegen den Abhang geschleuderte, drehte sich erneut und rutschte dann langsamer, dennoch ohne irgendwo Halt zu finden, tiefer in den Abgrund.
Delia verlor die Besinnung, noch bevor der Wagen zum Stillstand kam.
Wie lange sie hier schon lag, wusste sie nicht, als sie versuchte, langsam die Augen zu öffnen. Jeder Atemzug tat weh und schmerzte brutal. Die Dunkelheit um sie herum verhinderte, dass sie etwas erkennen konnte. Sie tastete mit dem linken Arm die nähere Umgebung ab. Die rechte Hand konnte sie nicht bewegen. Seltsamerweise verspürte sie keinen Schmerz in den Beinen.
Vorsichtig hob sie einige Zentimeter den Kopf an, ließ ihn aber sofort wieder sinken, als sie meinte, ein glühendes Schwert würde durch ihren Körper gestoßen. Delia schrie laut auf, während sie erneut versuchte, den Kopf zu drehen.
Sie fror. Sie lag auf einem nassen Teppich aus Blättern, Tannennadeln und Moos, so viel spürte sie, als sie mit der linken Hand die Umgebung abtastete. Verzweifelt rief sie um Hilfe.
Langsam setzte die Erinnerung ein. Es war kein Unfall, nein, es war ein Mordversuch, wie sie nun definitiv feststellte. Frank, ihr Prokurist, hatte den vorherigen Anschlag als Unfall abgewiegelt. Fast war sie geneigt ihm zu glauben. Es gab Ungereimtheiten in ihrer Firma. Noch bevor sie Meller damit konfrontieren konnte, merkte sie, dass Geld fehlte. Eine Buchung, die sie angeblich veranlasst hatte, und an die sie sich nicht erinnern konnte, ließen sie aufschrecken.
Sollte sie Blackouts haben? Frank Meller tat es mit einem Lächeln und Schulterzucken ab: „Kann doch jedem mal passieren“, meinte er. Sie und Ulla wurden misstrauisch. Ulla notierte sich klammheimlich die Kontobewegungen. Delia kontrollierte ihre Notizen ständig, ebenso den Kontostand.
Letztendlich merkte sie, dass nicht nur Geld fehlte, sondern auch Unterlagen. Die Bestätigung für einen größeren Auftrag verschwand, ebenso Unterlagen, die sie unterschrieben und Ulla auf den Schreibtisch gelegt hatte, als sie abends noch im Büro saß und arbeitete. Als sie am nächsten Tag später im Büro erschien, dachte sie, Ulla habe die Unterlagen weggeschickt. Ulla, normalerweise die Zuverlässigkeit in Person, gab einige Tage später an, nichts auf ihrem Schreibtisch vorgefunden zu haben. Der Auftrag, der nun nicht von ihr unterschrieben beim Auftraggeber landete, ging ihnen verloren. Leider war die Produktion angelaufen, und sie mussten für die medizinischen Geräte einen neuen Abnehmer finden. Der Verlust hielt sich zwar in Grenzen, dennoch …
„Bist du sicher, dass du ihn unterschrieben auf Ullas Schreibtisch gelegt hast?“ Sie erzählte Marcel einige Tage später von den merkwürdigen Vorkommnissen im Büro. Warum zweifelte er?
Erleichtert atmete sie auf, als Meller sich bereit erklärte, nach einem neuen Abnehmer dieser Geräte zu suchen. Den neuen Kunden hatte er überraschend schnell gefunden.
„Ich bin doch nicht senil“, erbost sprang sie Tage später vom Besprechungstisch auf, „ich fahre selbst nach München und hoffe, wenigstens diesen Auftrag zu ergattern. Dann hält sich der Verlust in Grenzen.“ Eigentlich wollte sie mit Marcel sprechen, er war aber nicht in seinem Büro.
Dafür meldete Ulla einen Besucher an: Antonio Sanderas, ihren alten Freund. Er kam selten nach Europa, besuchte sie aber jedes Mal, wenn er in Deutschland war. Der Gedanke, ihn in ihre Überlegungen einzuweihen kam spontan.
Aber bevor sie ihn um Rat fragen würde, wollte sie zunächst den Termin in München abwarten. Als sie kurze Zeit später zu Hause ihre Sachen packte, kam Marcel ihr entgegen.
„Du bist hier?“ Erstaunt starrte sie ihren Ehemann an.
„Ich könnte dich begleiten“, rief er zurück, „wann willst du losfahren?“
„Das wäre toll, kannst du denn weg?“ Er nickte.
Dass Frank Meller ebenfalls in München auftauchte, war nicht abgesprochen, dennoch war sie froh, dass er dabei war, denn die Verhandlungen waren zäh, und dank Franks Verhandlungsgeschick konnte er einen größeren finanziellen Verlust für die Firma abwenden.
War ihr Argwohn doch falsch gewesen? Sie hatte niemandem etwas von ihrem Verdacht erzählt, auch Antonio nicht. Mit ihm würde sie später reden und auch Adrian hinzubitten, der sicherlich bei ihrer Schwester in der Klinik zu finden war.
Und nun lag sie hier, in der Einsamkeit der Berge, inmitten der Wildnis. Keine Menschenseele weit und breit. Und sie fror erbärmlich. Verwundert stellte sie fest, dass die Wucht des Aufpralls sie aus dem Wagen geschleudert haben musste. Das letzte, woran sie sich erinnerte, war ihr Schrei und der Sturz in den Abgrund, nachdem der andere Wagen sie von der Straße gedrängt hatte.
Wie lange war das her?
Sie können bald weiterlesen


Leseprobe von
„Gnadenlos“
Prolog
10 Jahre vorher
Neumarkt
Der erste Schlag traf Nina an der Schläfe, der Schmerz stieß wie ein glühendes Schwert bis in ihr Gehirn. Zeit zum Ausweichen blieb nicht, der zweite Hieb setzte sofort nach. Sie meinte, ihr Kiefer wäre in zwei Stücke gebrochen, als sie auch schon in sich zusammensackte. Die Lippe schien aufgeplatzt, sie spürte, wie Flüssigkeit an ihrem Kinn herunterlief, Blut, soviel war sicher.
Julius Althofers Alkoholspiegel war auf einem erhöhten Level. Sich zu wehren, würde nur seine Aggressionen steigern. Sie hätte es ahnen müssen, dass er die Party nutzen würde, sie zu quälen und ihr vorzuhalten, dass sie an allem selbst schuld sei. Er wollte ihr Geld, er wollte Macht, er wollte sie brechen.
Er prügelte auf ihren Rücken ein, sie versuchte nur noch notdürftig ihren Kopf zu schützen, als er sie an den Haaren packte und zur Kellertreppe schleifte.
Als sie versuchte den Kopf zu drehen, blitzte etwas. Eine Hand, nicht die, die sie schlug, erkannte sie. Ein Siegelring? Oder … was hatte sie im Augenwinkel gesehen? Eine Täuschung? War sie nicht allein mit Julius? Sie versuchte sich mit den Händen kurz vor der Kellertreppe an der Wand festzuhalten, wurde aber gnadenlos weiter gezogen.
Hier in der Diele, weitab vom allgemeinen Trubel, konnte ihr niemand helfen. Die Gäste feierten im Garten. Sie hörte gedämpft die Musik im Hintergrund. Der allgemeine Geräuschpegel schwoll an, niemand würde ihr Rufen oder ihre Schreie hören, dafür sorgte Julius immer.
Der Fußtritt in ihren Unterleib ließ sie zusammenfahren. Sie schrie auf. Vor Schmerz ließ sie kraftlos die Wand los. Um sich vor weiteren Tritten zu schützen, rollte sie sich zusammen. Julius nutze die Gelegenheit und stieß sie die Treppe herunter. Im letzten Augenblick meinte sie, wie durch eine Nebelwand, ein Gesicht in der Diele zu erkennen. Sie stöhnte, der Schmerz trieb ihr Tränen in die Augen.
Ihr leises Schluchzen, das Weinen Ninas – nichts hinderte Julius daran, weiter brutal wie im Rausch zuzuschlagen.
Schnell hob sie beide Arme hoch, um den Kopf zu schützen, aber damit hatte er gerechnet, der nächste Fausthieb traf ihren Magen. Sie zuckte zu zusammen und sank in die Knie. Mit seinem rechten Fuß hatte er nun freie Bahn, holte aus und trat gegen ihren Kopf.
Nina schnappte nach Luft, ein weiterer Schrei, sie stöhnte, die Schmerzen wurden unerträglich. Dennoch blieb sie bei Bewusstsein. Verängstigt und überrascht musterte Nina Julius, mit so viel Wucht hatte er noch nie zugeschlagen. Warum werde ich nicht ohnmächtig? wunderte sie sich, als auch schon seine linke Hand in ihre Haare griff, heftig daran zog, so dass sie ihren Kopf heben musste, um anschließend mit seiner rechten Faust Nina einen Kinnhaken zu versetzen. Ihr Kopf flog nach hinten, ihr Hinterkopf schlug gegen die Kellerwand, irgendetwas knackte …
Ein trockenes Würgen entrann ihrer Kehle. Sie konnte nicht mehr atmen, nicht mehr schlucken, nicht mehr denken. Seine Augen schillerten wie zerbrochenes Glas, blitzen auf. Schmerz durchzuckte ihren Kopf. Nina versank in eine schwarze Wolke, suchte das Vergessen, wünschte sich, endlich in das tiefe Loch zu fallen, wie so oft zuvor.
Ihre Hilflosigkeit setzte eine höllische Energie und Wut in ihm frei, die ihn anspornte, grausamer zuzuschlagen.
„Nein, nicht … nein“, schrie sie mit kraftloser Stimme, als Julius sich ihr erneut näherte. Unter Mobilisierung ihrer letzten Kräfte rutschte sie auf dem nackten Betonboden nach hinten in eine schützende Ecke. Dort kauerte sie sich zusammen und drehte ihr Gesicht zur Wand, darauf wartend, dass er erneut heftig zuschlug und dass sich endlich das schwarze Loch unter ihr öffnete, um sie zu verschlingen und auszulöschen. Eine Besinnungslosigkeit, die sie hinunterzog in den kalten Schlund des Vergessens, der Ohnmacht und der Erschöpfung.
Dann überwältigte sie eine gnadenvolle Betäubung und riss sie mit sich in die Tiefen des Unterbewusstseins.
Als sie im Keller erwachte, wusste sie sofort, wo sie sich befand. Julius hatte sie besinnungslos in das Kellerverließ gezerrt und einfach auf dem kalten Steinboden liegen gelassen. Sie versuchte erst gar nicht, die Tür zu öffnen, denn auch wenn er noch so betrunken war, er vergaß schon lange nicht mehr abzuschließen. Stöhnend versuchte sie aufzustehen, um zumindest die Lampe einzuschalten. Im Dunkeln tastete sie sich vor und erreichte den Schalter.
Gottlob befanden sich ein WC und eine Waschgelegenheit im Nebenraum. Kriechend bewegte sie sich zum Waschbecken. Vorsichtig fuhr sie mit der linken Hand über ihr Gesicht, tastete es ab. Es schien nur noch aus einer undefinierbaren Masse zu bestehen.
Sie fühlte eine einzige offene Wunde, sie spürte das Blut. Ihren rechten Arm konnte sie nicht bewegen, gebrochen, wie sie sich eingestehen musste.
Erneut schrie sie stöhnend auf. Jede Bewegung, jede Erschütterung verursachte Höllenqualen. Mittlerweile kannte sie die Schmerzen, kannte die Folter, die Qual mit der sie nun alleine fertig werden musste. Vorläufig würde sich niemand um sie kümmern.
Langsam setzte der erbarmungslose Schmerz ein. Sie musste sich übergeben und meinte ihre letzte Stunde hätte geschlagen. Sie spukte Blut, das Sehen fiel ihr schwer, alles verschwamm vor ihren Augen. Das Pochen in ihrem Schädel steigerte sich ins Unermessliche.
Urplötzlich hörte sie ein Geräusch. Es kam von der Tür her. Sie zuckte zusammen. Würde Julius abermals zu ihr kommen? Sie in seinem ungezügelten Zorn nochmals zusammenschlagen? Oder einer der anderen brutalen, rücksichtslosen Kerle? Wann nahm diese Qual endlich ein Ende?
Langsam drehte sich der Schlüssel von außen im Schloss der Tür. Bedächtig wurde die Türklinke heruntergedrückt und zögernd die Tür langsam aufgezogen.
Nina zuckte zusammen, sie erstarrte. Fassungslosigkeit machte sich breit. Nina erkannte die Person, die sich ihr näherte, und schrie entsetzt auf.
Kapitel 1
Gegenwart Neumarkt
„Herr Althofer, Sie haben Ihre Frau für tot erklären lassen, sämtliche Fristen wurden eingehalten, nun ist es so weit.“ Der Rechtsanwalt, der Julius Althofer die niederschmetternde Mitteilung übermittelte, grinste – nur innerlich, äußerlich gelassen, fuhr er fort: „Ihre Frau Nina hatte während Ihrer Ehe nicht die Möglichkeit über ihr Geld zu verfügen, stimmt das?“
„Sie musste kurz gehalten werden“, erwiderte Althofer, „sie konnte nicht mit Geld umgehen, das haben meine Mutter und ich für sie erledigt. Ihr Geld wurde auf ein Konto hinterlegt und nicht angetastet. Es war stets auch die Unterschrift meiner Frau bei jeder Transaktion nötig.“
„Von Ihrer Mutter und Ihnen wurde das Geld verwaltet? So, so.“ Konrad Melanger, Notar, Rechtsanwalt und Nachlassverwalter, konnte sich die kleine, bissige Bemerkung nicht verkneifen. Nach Durchsicht seiner Unterlagen, schien die seit zehn Jahren vermisste und nun für tot erklärte Ehefrau von Julius Althofer es nicht leicht gehabt zu haben. Die herrische Familie, in die sie vor zwanzig Jahren einheiratete, nahm ihr das Geld kurz nach der Hochzeit weg, lagerte es auf ein Konto ein, zu dem der Ehemann und seine Mutter Franziska, mittlerweile fast neunzig Jahre alt, Zugriff hatten. Glücklicherweise musste jede Abhebung von Nina Althofer gegengezeichnet werden. Melanger hatte sich bei der Bank erkundigt, es schien noch vorhanden zu sein. Kein Wunder, ohne Nina Althofers Unterschrift kamen sie nicht an das Geld. Und Nina Althofer war seit über zehn Jahren spurlos verschwunden.
„Meine Frau war nicht imstande, ihr Erbe selbständig zu verwalten“, versuchte Althofer erneut eine Erklärung, „nicht, dass Sie meinen, ich hätte sie damals ihres Vermögens wegen geheiratet.“ Nun wirkte er vorsichtig.
Ach, nein? Da bin ich anderer Meinung, dachte Melanger, du hast ihr das Geld genommen und sie als billige Kraft, Putzfrau und Pflegerin deiner Mutter behalten, laut sagte Melanger:
„Was ich denke, ist unwichtig. Fakt ist, sie hat ein Testament hinterlassen.“
„Wie bitte“, nun fuhr Althofer hoch, sprang aus seinem Sessel und stützte sich auf dem Schreibtisch vor sich ab, „ein Testament? Dazu war sie doch zu blöd. Wie hätte sie das machen sollen? Das werde ich anfechten.“
„Warum, Herr Althofer? Anfechten? Aus meinen Unterlagen geht hervor, dass Ihre Frau nicht unter Ihrer Betreuung stand.“
„Natürlich nicht, ich wollte eine solche Blamage meinen Kindern nicht zumuten“, donnerte er, „wie hätte es ausgesehen, eine Mutter zu haben, die“, er suchte nach Worten, „bekloppt ist? Meine Söhne haben es natürlich selbst festgestellt, aber …“
„Tja“, meinte Melanger, „dann verfasste sie das Testament im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, und es ist gültig.“
„Ich fechte es an!“
„Leider wird das nicht einfach werden, zumal eine gewisse“, Melanger blätterte in seinen Unterlagen, „Eva Vortkamp sie zum Rechtsanwalt begleitet hatte. Sie unterschrieb damals als Zeugin.“
„Eva Vortkamp?“ Althofer schrie den Namen. „Das ist unsere Nachbarin. Sie steckte mit meiner Frau unter einer Decke, dieses Miststück, dieses Luder“, er beherrschte sich, doch sein hochroter Kopf besagte etwas anderes, „sie hat meine Frau aufgehetzt. Ist sie in dem Testament auch begünstigt?“
Melanger schüttelte den Kopf. „Niemand von Ihnen, Herr Althofer, Ihre Frau hat ihr Geld einer Stiftung hinterlassen.“
„Einer Stiftung?“ Althofer spuckte Gift und Galle. „Das Testament kann nicht von meiner Frau sein, sie hätte das Geld ihrer Familie hinterlassen, ihren Söhnen und auch mir.“
„Ihre Frau hat Briefe hinterlassen. Sie sind bereits an die Empfänger verschickt worden, Herr Althofer“, Melanger genoss den Triumpf, diesem abstoßenden Mann den Rest zu geben, „adressiert waren sie an die Eva Vortkamp, an die Polizei und – ach ja, ich erinnere mich, an Sie und Ihre Söhne. Allerdings werden sie Ihnen erst bei der Testamentseröffnung überreicht, und die ist in einer Woche. Ich darf Ihnen das Schreiben und die Einladung überreichen? Das gilt auch für Ihre Söhne.“
Mit eiskalten Augen nahm Melanger drei Schreiben aus seiner Mappe und legte sie vor Althofer auf den Tisch.
Fast tat Althofer ihm nun leid – denn er kannte den Inhalt aller Briefe. Doch Mitleid konnte man mit diesem Mann nicht haben. Er empfand eher ein Gefühl der Genugtuung. Als er aufstand, erlebte er einige Sekunden der Zufriedenheit, schüttelte diesen Sinnesreiz ab und konzentrierte sich erneut auf seinen eigentlichen Auftrag.
„Sie werden in den nächsten Tagen von den Personen hören, denen Ihre Frau Nachrichten hinterlassen hat.“ Er raffte seine Unterlagen zusammen, stopfte sie zurück in seine Mappe, nickte kurz und wandte sich dem Ausgang zu.
In seinem Wagen atmete Melanger tief durch. Die erste Hürde wäre geschafft. Bevor er den Motor startete, zwang er sich zu einem Lächeln.
Nina Althofer, eine Frau, die vor zehn Jahren spurlos verschwand, hatte vorgesorgt. Ihm lief ein kalter Schauer über den Rücken, als er daran dachte, was in den Briefen stand. Wusste Althofer davon? Sicherlich nicht. Den Stein brachte er persönlich ins Rollen, als er den Antrag stellte, seine Frau für tot zu erklären.
Interesse weiter zu lesen? Das Buch ist ab sofort im Handel erhältlich
![1045059_433458970098846_836323128_n[1]](http://www.heidrun-buecker.de/wp-content/uploads/2012/06/1045059_433458970098846_836323128_n1-300x168.jpg)
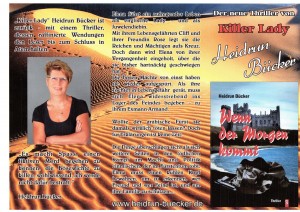
„Wenn der Morgen kommt“
Das hektische Treiben auf dem festlichen Bankett ließ dem Personal keine Zeit, auch nur kurz zu verschnaufen. Es ging auf Mitternacht zu. Musik untermalte leise die ausgelassene, fröhliche Atmosphäre. Überall gruppierten sich die Gäste, unterhielten sich. Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch vermischten sich untereinander.
Eine schmale Person, halb versteckt hinter großen Palmen, die in noch größeren Töpfen in der Halle standen, mit davor arrangierten, anderen grünen Tropengewächsen, beobachtete verhalten die Menschenmenge. Sie ließ die Blicke in alle Richtungen schweifen, suchte und fand die blonde Person. Ein kurzer Augenkontakt signalisierte: Es beginnt.
Sofort strafften sich ihre Schultern, geschäftig trat sie hinter den Pflanzen hervor. Nun verlangte die Lage höchste Konzentration.
Zuerst bemerkte sie ihn nicht, schenkte dem dunkelhaarigen, jungen Mann keine Beachtung, der zielstrebig in ihre Richtung lief. Sie wandte sich dem Ort zu, an dem sich ihre Kontaktperson aufhielt, die nun mit völligem Desinteresse ihre Blicke durch das Publikum schweifen ließ. Sie näherte sich dieser blonden Frau langsam, ruhig, aber mit gezielten Schritten. Als sie sich auf gleicher Höhe mit dem jungen Mann befand, durchfuhr sie ein Schauer, eine irrationale Empfindung, die sie nicht zuordnen konnte. Als ihre linke Hand die rechte des jungen Mannes streifte, war es wie ein Stromschlag, der ihren Körper durchfuhr. Auch der junge Mann bemerkte es, stockte, verharrte den Bruchteil einer Sekunde, schüttelte das kurze, minimale Unwohlsein verunsichert ab und lief zögerlich weiter.
Elena hatte diese Situation mehr mitgenommen, als sie es sich zunächst selbst eingestehen wollte. Ein Gedankenblitz durchzuckte ihr Gehirn. Dieser junge Mann … diese Ähnlichkeit, diese … Nein, das konnte nicht sein. Sie irrte sich … sie musste sich irren … es war nur … Ja, was?
Etwas explodierte in ihrem Inneren. Ihr Herz hämmerte, ihr Puls raste. Eine vage Erinnerung, noch nicht greifbar. Sie musste sich mit aller Macht auf ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren. Es fiel ihr schwer. Die blonde Frau suchte nun ihrerseits wiederholt Blickkontakt, runzelte leicht die Stirn und suchte die Umgebung ab. Sie konnte aber nicht erkennen, was ihre Mitstreiterin aus der Fassung gebracht hatte.
Neugierig?
Ich hoffe, das Interesse geweckt zu haben. Ab Dezember im Handel.
Schardt Verlag ISBN 978-3-89841-725-9 12,80 €
natürlich auch als E-Book erhältlich
Prolog
23 Jahre zuvor
Die Wagenkolonne rollte durch hellen, weißen Sand. Vereinzelt Steine, ab und zu Felsen, an denen sich der Fahrer orientieren konnte. Der Chauffeur schien genau zu wissen, wo er sich befand. Eine Straße war nicht zu sehen. Ab und zu nahm man Reifenspuren wahr, wenn der Untergrund aus Felsen oder Kies bestand. Die Strecke bis ins nächste Dorf zog sich hin. Außer einigen zerklüftete Felsen, die als Wegweiser dienten, einigen Steinhaufen, von Menschenhand aufgeschichtet, war nur der wolkenlose, blaue Himmel und der vor Hitze flirrende Sand zu sehen. Im Wageninneren brummte die Klimaanlage auf Hochtouren. Die Temperatur kletterte draußen auf über fünfundvierzig Grad. Schatten gab es nicht.
Hin und wieder begegnete ihnen ein anderes Auto, selten zwar, aber doch bestand eine Busverbindung zur Oase. Die schon älteren Fahrgelegenheiten, die ihnen entgegenkamen, erfüllten ihren Zweck. Zweimal täglich pendelten diese größeren, alten Jeeps zwischen der modernen, westlich orientierten Hauptstadt des Wüstenlandes am Meer und dem Hinterland. Sie begegneten einigen Kamelen, die unter den wenigen Palmen, die den Weg säumten, standen und sich ausruhten. Nach fast einer Stunde Fahrt, die die Insassen des mittleren Wagens fast schweigend zurücklegten, erreichten sie eine Art Kreuzung.
„Hoheit“, wagte der Begleiter, der auf dem Beifahrersitz saß, zu fragen, „wenn Sie uns sagen, wen Sie aufsuchen wollen, in der Oase, dann könnten wir …“
Weiter kam er nicht. Der Angesprochene winkte ab. „Ich bin mir selbst nicht sicher“, sagte er, „ich erkläre es euch, wenn ich mit der Frau gesprochen habe.“ Nachdenklich hielt er einen Brief in der Hand, den er immer wieder las, dann aber in seinem weißen Gewand verschwinden ließ. „Der Brief ist von einer entfernten Verwandten, von deren Existenz ich nichts ahnte. Ich verstehe es nicht genau, aber sie ist im Besitz bedeutungsvoller Informationen, die sie mir unbedingt persönlich anvertrauen will. Es ist äußerst wichtig, schrieb sie mir.“
„Eine Verwandte?“ Sein Begleiter Mohammed, seit Jahren sein engster Vertrauter, blickte ihn misstrauisch an. „Karim“, wenn sie alleine waren, ließ er die formelle Anrede beiseite, „warum hast du uns nichts gesagt? Wir hätten es erst einmal überprüft. Ist es denn möglich, dass du noch eine entfernte Cousine hast, von der du bislang nichts wusstest? Die du nicht einmal kennst? Das halte ich für unmöglich. Es könnte eine Falle sein!“
Karim schüttelte den Kopf. „Daher habe ich nichts von dem Brief gesagt. Es weiß niemand, dass wir auf dem Weg zu ihr sind. Sie bat um die Unterredung, nur sie weiß, dass wir heute kommen.“
„Aber“, begann Mohammed nochmals, „es ist möglich, dass der Überbringer der Botschaft abgefangen wurde. Karim, es wäre nicht das erste Mal, dass man auf diese Art versucht, dich in einen Hinterhalt zu locken.“
Karim schüttelte energisch den Kopf. „Nein! Sie wusste über Dinge Bescheid, die nur wenige kennen können. Ich habe den Eindruck, sie will mich vor etwas warnen, vor …“ Er schwieg, war sich nicht sicher, diese brisante Information an seinen Begleiter weiterzugeben. Er blieb vage.
„Es geht um die Familie, um engste Familienmitglieder, um Dinge, die …“ Gedankenvoll blickte er aus dem Wagenfenster. „Ist es noch weit bis zur Oase?“
Der Fahrer schüttelte den Kopf. „Nein, Hoheit, wir sind schon an der Kreuzung angelangt, wir biegen nun rechts ab und fahren fast direkt darauf zu. Links geht es zu dem alten Militärflughafen und geradeaus ins Gebirge.“
An der Kreuzung stand an der linken Seite ein verrostetes Hinweisschild. Einige Autowracks zierten den Straßenrand, halb mit Wüstensand bedeckt. Der Verkehr nahm zu, mehrere Laster, einige Jeeps und Eselskarren benutzten die Straße. Kinder zogen mit Kamelen am Weg entlang und bestaunten den Konvoi von vornehmen, schwarzen Geländewagen. Ein kleiner Junge näherte sich neugierig den drei Wagen, die das Tempo verringern mussten, um abzubiegen. Er lächelte und winkte den Insassen zu. Eins der Kamele versperrte ihnen den Weg, so dass der Fahrer des ersten Wagens stehen bleiben musste.
Der Junge kam neugierig näher, lugte in den Wagen, klopfte an die Scheibe des mittleren Autos und deutete auf das als Geschenk verpackte Paket in seiner Hand. Der junge Mann, der neben dem Herrscher des kleinen Wüstenstaates saß, öffnete die Wagentür und nahm den Karton lächelnd an.
Noch bevor er sich bedanken konnte, verschwand die Freundlichkeit aus den Augen des Jungen, der Blick des Kindes wurde verschlagen und hinterlistig.
Als der Junge sich umdrehte und wegrannte, hatte Mohammed erkannt, was dieses Ding, das er in seiner Hand hielt, war. Eine Bombe. Die Wucht der Explosion erschütterte die drei Fahrzeuge. Die Insassen der Autos in der Nähe sahen zunächst nur einen glühend weißen Blitz und dann einen sehr viel größeren, orangeroten Feuerball, bis sich schließlich eine dichte, dunkelgraue Wolke bildete. Die gesamte Umgebung lag voller Glassplitter, brennende Metallteile rieselten auf die Erde. Ein sanfter Regen aus hellem, weißem Wüstensand folgte, bevor sich eine seltsame, unheimliche Stille über die bizarre Kulisse breitete.
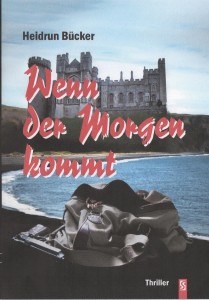

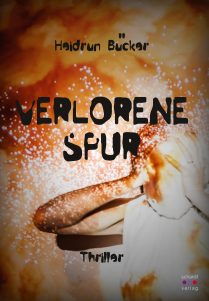

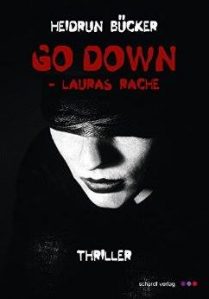

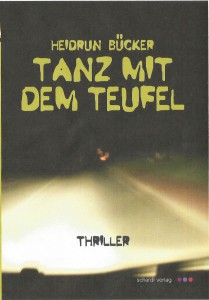






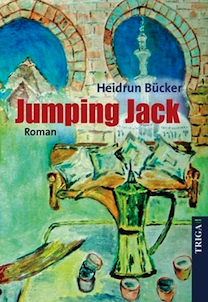
Hinterlassen Sie ein Kommentar